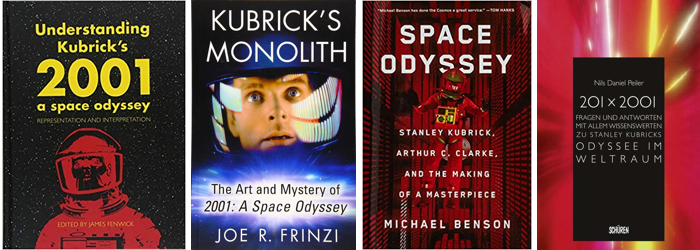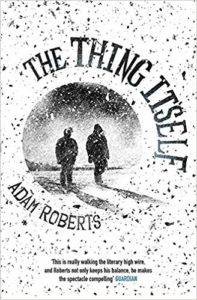Adam Roberts ist eine jener Gestalten, die uns Normalsterblichen das Gefühl geben, etwas grundlegend falsch zu machen. Roberts ist Professor für Englische Literatur an der University London; offiziell ist die Literatur des 19. Jahrhunderts sein Schwerpunkt. Neben all dem, was er in diesem Bereich veröffentlicht, publiziert er regelmässig Wissenschaftliches zu Science Fiction und verwandten Genres und schreibt mindestens einen Roman pro Jahr. Dazu betreibt er noch gefühlte 17 Blogs und ist ominipräsent auf Twitter und Facebook. Ach ja, er ist übrigens glücklich verheiratet und Vater zweier (?) Kinder.
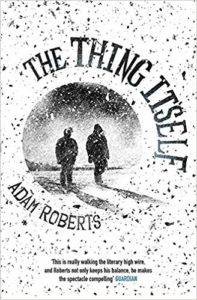 Ich kannte Roberts bisher nur durch seine wissenschaftlichen Texte und seine diversen Online-Aktvitäten, wollte mir aber schon seit Längerem auch mal einen seiner Romane zu Gemüte führen. Nun habe ich es endlich geschafft, The Thing Itself zu lesen, dessen Beschreibung mich sehr gereizt hat. Was folgt, ist keine ausgewachsene Rezension, sondern eher einige ungeordnete Eindrücke.
Ich kannte Roberts bisher nur durch seine wissenschaftlichen Texte und seine diversen Online-Aktvitäten, wollte mir aber schon seit Längerem auch mal einen seiner Romane zu Gemüte führen. Nun habe ich es endlich geschafft, The Thing Itself zu lesen, dessen Beschreibung mich sehr gereizt hat. Was folgt, ist keine ausgewachsene Rezension, sondern eher einige ungeordnete Eindrücke.
Roberts versucht in The Thing Itself etwas ziemlich Verrücktes – er macht Immanuel Kants in der Kritik der reinen Vernunft entwickelte Transzendetalphilosophie als Novum für die SF fruchtbar. Nach Kant ist die Welt – bzw. in seiner Terminologie das Ding an sich – nie direkt erfahrbar; wir sind in unserer Wahrnehmung immer durch die fundamentalen Kategorien unseres Denkens wie Zeit, Raum, Kausalität etc. beschränkt. Diese sind demnach nicht Eigenschaften der Welt, sondern die unhintergehbaren Parameter unseres Zugriffs auf die Welt. Wesen, deren Verstand anders strukturiert ist als unserer, nehmen die Welt zwangsläufig anders wahr.
So weit das erkenntnistheoretische Einmaleins. Roberts fragt nun danach, ob es möglich wäre, eine AI zu bauen, die – da nicht menschlich – nicht diesen Beschränkungen unterliegt und dadurch einen direkteren Zugriff auf das Ding an sich hätte, dieses sogar bis zu einem gewissen Grad manipulieren könnte. Ich bin nicht sicher, ob wir zumindest theoretisch tatsächlich in der Lage sind, eine Intelligenz zu konstruieren, die nicht bis zu einem gewissen Grad anthropomorph ist, aber ein interessanter Ausgangspunkt für eine SF-Geschichte ist das auf jeden Fall.
Der Auftakt des Romans ist grandios: Roberts verbindet seine Kant-Grundidee mit einem deutlich an John Carpenters The Thing angelehnten Antarktis-Setting und einer guten Prise H. P. Lovecraft. Die beiden Forscher Charles und Roy machen am Südpol eine in jeglicher Hinsicht erschütternde Erfahrung, wobei zu diesem Zeitpunkt nicht klar ist, ob sie tatsächlich zum Ding an sich vorgestossen oder mit einer ausserirdischen Intelligenz in Kontakt gekommen sind – oder beidem.

Was meint Kurt Russell zu Kant?
Hier wie an vielen anderen Stellen wird sichtbar, aus wie vielen Register der Autor schöpft. Roberts kennt die Geschichte der SF ebenso wie philosophische Tradition und verschmilzt diese kunstvoll (im Folgekapitel zeigt sich Roberts dann als H.-G.-Wells-Kenner).
Im Folgenden hat das Buch eine alternierende Struktur: Der im ersten Teil begonnene Hauptstrang mit dem Protagonisten Charles wechselt jeweils mit anderen abgeschlossenen Episoden ab, die auf den ersten Blick nichts mit dem Rest zu tun haben, sich schliesslich aber zu einem grossen Ganzen zusammenfügen. In diesen Episoden wechselt auch der Erzählstil markant; es gibt einen deutlich von James Joyces Molly-Bloom-Monolog in Ulysses inspiriertes Kapitel, ein Bekenntnis eines misshandelten Dieners im England des 16. (?) Jahrhunderts etc.
Ich habe das Buch in wenigen Tagen gelesen, zwei Dinge haben mich gegen Ende allerdings gestört: Zum einen ist Charles eine relativ passive Hauptfigur, die fortlaufend mit neuen körperlichen Gebrechen konfrontiert ist. Sein zunehmendes Gejammer hat mich zusehends genervt; zugleich wirkt die Action des Plots teilweise forciert und ein bisschen zu bewusst als Gegenstück zu den Passagen, in denen Kant referiert wird.
Ich bin auch kein allzu grosser Fan des Stilmittels, jedes Kapitel in einem anderen Tonfall zu erzählen. Natürlich: Wenn das wirklich klappt, ist es schön, aber ich hatte an einigen Stellen den Eindruck, dass Roberts ein Kapitel nur deshalb „ungewohnt“ erzählt, damit die Struktur erhalten bleibt, ohne dass daraus ein echter Mehrwert entstünde. Dies gilt insbesondere für ein Kapitel, das wie ein Drehbuch geschrieben ist; in meinen Augen eine eher sinnlose Übung.

Adam Roberts
Trotz dieser beiden Einschränkungen ein interessanter Roman, nicht zuletzt, weil Roberts Überlegungen zu Kant auf eine Art Gottesbeweis hinauslaufen. Die Grundidee: Mit dem Ding an sich existiert etwas, das sich unserer Wahrnehmung teilweise entzieht, das aber in irgendeiner Form lebendig, dynamisch sein muss:
Twenty-first century atheists peer carefully at the world around them and claim to see no evidence for God, when what they’re really peering at is the architecture of their own perceptions. Spars and ribs and wire-skeletons – there’s no God there. Of course there’s not. But strip away the wire-skeleton, and think of the cosmos without space or time or cause or substance, and ask yourself: is it an inert quantity? If so, how could … how could all this?
In den «Acknowledgments» bezeichnet sich Roberts als «an atheist writing a novel about why we should believe in God». Von einem traditionellen Gottesverständnis ist diese numinose, irgendwie auf unsere Welt einwirkende Ding an zwar ziemlich weit weg. Ich weiss zudem nicht, wie originell diese Überlegungen sind, inwieweit Roberts hier bereits existierende Ideen aufnimmt, aber seine Überlegungen sind auch und gerade für einen überzeugten Atheisten wie mich interessant.
Roberts, Adam: H. G. Wells. A Literary Life. Palgrave Macmillan: London 2019.
–: The History of Science Fiction. 2. Aufl. Palgrave Macmillan: London 2016.
–: Science Fiction. 2. Aufl. Routledge: London/New York 2006.
–: The Thing Itself. Gollancz: London 2015.