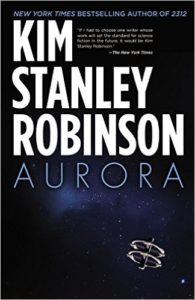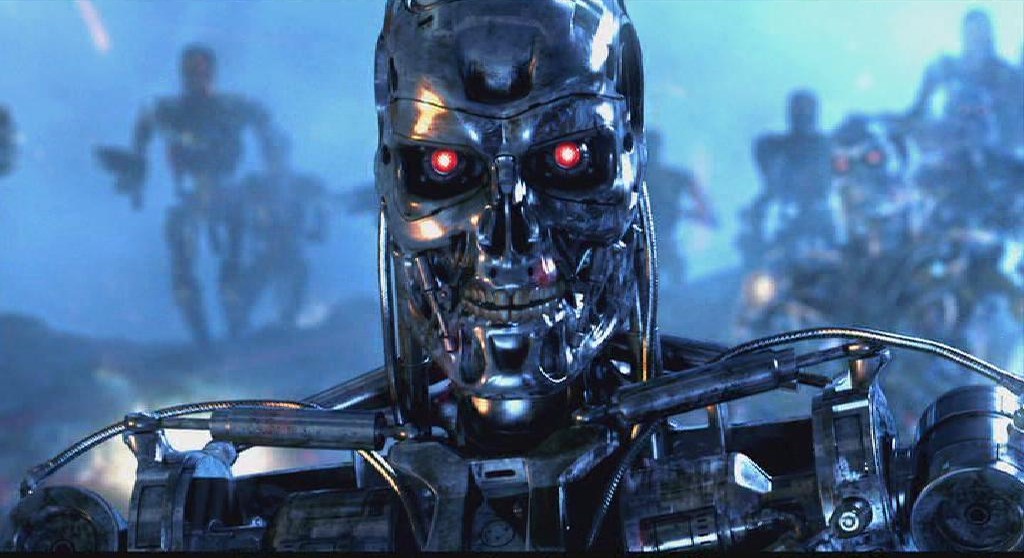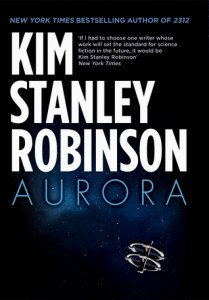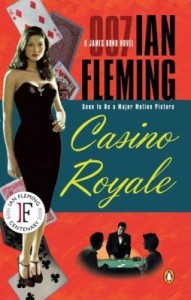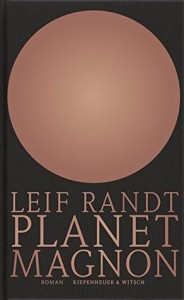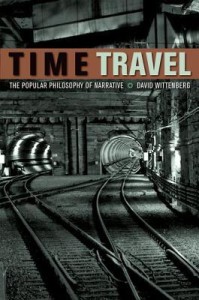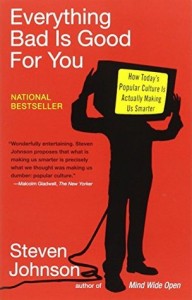Zur Kategorie «Statistiken, die die Welt nicht braucht» gehört die folgende Auflistung aller Filme und Bücher, die ich mir im vergangenen Jahr zu Gemüte geführt habe. Natürlich fein säuberlich nach Kategorien geordnet.
Das erste Mal – Filmische Premieren
Im Folgenden sind alle Filme chronologisch aufgeführt, die ich 2015 zum ersten Mal gesehen. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es insgesamt 73 Titel. Die Auswahl reicht dabei von brandneuen Blockbustern wie Mad Max: Fury Road oder Star Wars: The Force Awakens bis zu filmhistorischen Stücken wie Marie-Louise oder The Jazz Singer (die übrigens beide nicht so schlecht waren wie befürchtet). Die meisten Filme habe ich leider nicht im Kino gesehen, sondern in meinen eigenen vier Wänden. Nicht aufgeführt sind Fernsehserien und – mit wenigen Ausnahmen – Kurzfilme. Die filmischen Highlights waren wohl Inside Out und Mad Max: Fury Road.

Mad Max: Fury Road
Im Keller, Ulrich Seidl, AT 2014.
Christian Schocher, Filmemacher, Marcel Bächtiger und Andreas Mueller, CH 2015.
Das dunkle Gen, Miriam Jakobs und Gerhard Schick, DE/CH 2014.
The Jazz Singer, Alan Crosland, USA 1927 (siehe dazu Wie die Juden Hollywood erfanden).
John Wick, Chad Stahelski, USA 2014.
Driften, Karim Patwa, CH 2015.
The Interview, Evan Goldberg und Seth Rogen, USA 2014.
Wild Tales, Damián Szifrón, AR/ES 2014.
Austin Powers: International Man of MysteryJay Roach, USA/DE 1997.
Jupiter Ascending, Andy und Lana Wachowski, USA/AU 2015.
Adieu au langage, Jean-Luc Godard, CH/FR 2014.
Everything or Nothing: The Untold Story of 007, Stevan Riley, GB 2014.
Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), Alejandro G. Iñárritu, USA 2014.
Predestination, Michael und Peter Spierig, AU 2014.
Divergent, Neil Burger, USA 2014.
Insurgent, Robert Schwentke, USA 2015.
Kingsman: The Secret Service, Matthew Vaughn, GB 2014.
Ex Machina, Alex Garland, GB 2015 (siehe meine Rezension).
Une nouvelle amie, François Ozon, FR 2014.
Avengers: Age of Ultron, Joss Whedon, USA 2015 (siehe meine Rezension).
Bouboule, Bruno Deville, BE/CH 2014.
Das ewige Leben, Wolfgang Murnberger, AT 2015.
Mad Max: Fury Road, George Miller, AU/USA 2015.
Tomorrowland, Brad Bird, USA/ES 2015 (siehe diesen und diesen Blogeintrag).
Freak Out!, Carl Javér, NO/DE/DK/SE/GB/USA/CH/AT 2014.
Jurassic World, Colin Trevorrow, USA 2015.
Terminator Genisys, Alan Taylor, USA 2015.
The Visit, Michael Madsen, DK/AT/IR/FI/NO/SE/NL 2015 (siehe meinen Text für das Programmheft des Filmpodiums).
Into Eternity: A Film for the Future, Michael Madsen, DK/FI/SE/IT 2010.
Mission: Impossible – Rogue Nation, Christopher McQuarrie, USA 2015 (siehe meine Rezension).
Utopia, John Pilger, GB 2013.
Atlas Shrugged Part I, Paul Johansson, USA 2011.
My Dinner with André, Louis Malle, USA 1981.
Birth, Jonathan Glazer, USA/GB/DE/FR 2004.
CQ, Roman Coppola, USA/LU/FR/IT.
Thief, Michael Mann, USA 1981.
Ich seh, ich seh, Severin Fiala, Veronika Franz, AT 2014 (siehe meine Spoiler-Kolumne).
The Wolfpack, Crystal Moselle, USA 2015 (siehe meine Rezension).
Inside Out, Pete Docter, Ronnie Del Carmen, USA 2015.
The Time Traveler’s Wife, Robert Schwentke, USA 2009.
Legend, Ridley Scott, USA/GB 1985.
Antonia’s Line, Marleen Gorris, NL/BE/GB/FR 1995.
Dürrenmatt: Eine Liebesgeschichte, Sabine Gisiger, CH 2015 (siehe Der Dichter und seine Frau).
Marie-Louise, Leopold Lindtberg, CH 1944 (siehe Wie Dutti den Oscar gewann).
Wednesday, May 9, Vahid Jalilvand, IR 2015.
Fish & Cat, Shahram Mokri, IR 2013.
Incendies, Denis Villeneuve, CA 2010.
The Martian, Ridley Scott, USA/GB 2015.
The Zero Theorem, Terry Gilliam, GB/RO/FR/USA 2013.
Black Mass, Scott Cooper, USA/GB 2015.
Spectre, Sam Mendes, GB/USA 2015 (siehe meine Rezension).
Meteor, Christoph Girardet und Matthias Müller, DE 2011.
Afronauts, Frances Bodomo, USA 2014.
Swiss Made, Fredi M. Murer, CH 1968.
Keeping the Faith, Edward Norton, USA 2000.
Enemy of the State, Tony Scott, USA 1998.
Heimatland, Lisa Blatter, Gregor Frei, Benny Jaberg, Carmen Jaquier, Jonas Meier, Tobias Nölle, Lionel Rupp, Mike Scheiwiller, Jan Gassmann, Michael Krummenacher, CH 2015.
The Driller Killer, Abel Ferrara, USA 1979.
Hitchcock/Truffaut, Kent Jones, FR/USA 2015.
Köpek, Esen Isik, CH/TR 2015 (siehe Ein Hunde-Elend).
It Follows, David Robert Mitchell, USA 2014.
Projections of America, Peter Miller, DE/USA/FR 2014.
Legend, Brian Helgeland, GB/FR 2015 (siehe meine Rezension).
The Krays, Peter Medak, GB 1990.
Star Wars: The Force Awakens, J.J. Abrams, USA 2015 (siehe Die Macht der Nostalgie).
Point Break, Ericson Core, DE/CN/USA 2015.
The Revenant, Alejandro G. Iñárritu, USA 2015.
Schellen-Ursli, Xavier Koller, CH 2015.
The Hateful Eight, Quentin Tarantino, USA 2015.
Nichts passiert, Micha Lewinsky, CH 2015.
Rider Jack, This Lüscher, CH 2015.
Youth, Paolo Sorrentino, IT/FR/CH/GB 2015.
Reprisen
Die ersten Monate waren filmisch von meiner Recherche für einen Artikel zur James-Bond-Reihe geprägt, der dieses Jahr erscheinen sollte (gewissermassen eine Light-Version ist als Ikone des Zeitgeists in der Filmzeitschrift Frame erschienen). Ansonsten war – natürlich – Barry Lyndon wieder einmal ein alles andere überragendes Highlight.

Der erste Auftritt des einzig wahren James Bond: Sean Connery in Dr. No.
Dr. No, Terence Young, GB 1962.
From Russia With Love, Terence Young, GB 1963.
Goldfinger, Guy Hamilton, GB 1965.
Thunderball, Terence Young, GB 1965.
You Only Live Twice, Lewis Gilbert, GB 1967.
On Her Majesty’s Secret Service, Peter Hunt, GB 1969.
Diamonds Are Forever, Guy Hamilton, GB 1971.
Live and Let Die, Guy Hamilton, GB 1973.
The Man with the Golden Gun, Guy Hamilton, GB 1974.
When Harry Met Sally…, Rob Reiner, USA 1989.
The Spy Who Loved Me, Lewis Gilbert, GB 1977.
Moonraker, Lewis Gilbert, GB/FR/USA 1979.
For Your Eyes Only, John Glen, GB/USA 1981.
Octopussy, John Glen, GB/USA 1983.
Never Say Never Again, Irvin Kershner, GB/USA/DE 1983.
A View to a Kill, John Glen, GB/USA 1985.
The Living Daylights, John Glen, GB/USA 1987.
Under the Skin, Jonathan Glazer, GB/USA/CH, 2013.
Terminator 2: Judgment Day, James Cameron, USA/FR 1991.
Spartacus, Stanley Kubrick, USA 1960.
The Terminator, James Cameron, GB/USA 1984.
Barry Lyndon, Stanley Kubrick, GB/USA/IR 1975.
Interstellar, Christopher Nolan, USA/GB 2014 (siehe Nachricht von Papi).
GoldenEye, Martin Campbell, GB/USA 1995.
Tomorrow Never Dies, Roger Spottiswoode, GB/USA 1997.
Les 400 coups, François Truffaut, FR 1959.
Mad Max, George Miller, AU 1979.
Mad Max 2: The Road Warrior, George Miller, AU 1981.
The World Is Not Enough, Michael Apted, GB/USA 1999.
Die Another Day, Lee Tamahori, GB/USA 2002.
Casino Royale, Martin Campbell, GB/CZ/USA/USA/DE/BS 2006.
Quantum of Solace, Marc Forster, GB/USA 2008.
Skyfall, Sam Mendes, GB/USA 2012.
True Lies, James Cameron, USA 1994.
Sexy Beast, Jonathan Glazer, GB/ES 2000.
Drive, Nicolas Winding Refn, USA 2011.
The Omega Man, Boris Sagal, USA 1971.
Johnny Guitar, Nicholas Ray, USA 1954.
There’s Something About Mary, Bobby und Peter Farrelly, USA 1998.
Back to the Future, Robert Zemeckis, USA 1985.
Back to the Future Part II, Robert Zemeckis, USA 1989.
Point Break, Kathryn Bigelow, USA/JP 1991.
Fargo, Joel und Ethan Coen, USA/GB 1996.
Love Actually, Richard Curtis, GB/USA/FR 2003.
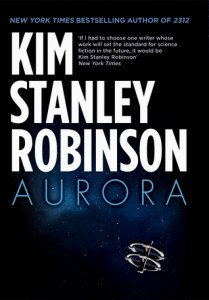
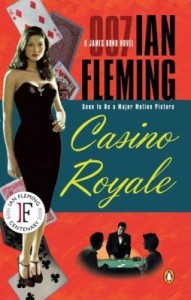
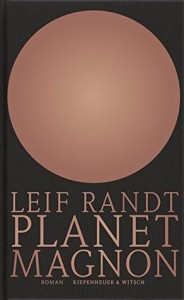
Literatur –
Belletristik
Allzu viele Romane habe ich 2015 nicht geschafft, und fast die Hälfte waren Teil meiner James-Bond-Recherchen. Die Highlights waren auf jeden Fall Michel Fabers Under the Skin (sehr anders als der grossartige Film von Jonathan Glazer, aber definitiv eine Entdeckung) sowie Kim Stanley Robinsons Aurora. Robinsons Roman ist nicht perfekt, aber ebenfalls lesenswert.
Ian Fleming: Casino Royale.
Ian Fleming: Live and Let Die.
Ian Fleming: Moonraker.
Ian Fleming: Diamonds Are Forever.
Faber, Michel: Under the Skin.
Leif Randt: Planet Magnon (siehe meine Rezension).
Ian Fleming: From Russia With Love.
Ian Fleming: Dr. No.
Kim Stanley Robinson: Aurora.
Morus, Thomas: Utopia. Aus dem Englischen übers. von Michael Siefener. Wiesebaden 2013 (siehe meine Rezension).
Samuel R. Delany: The Jewels of Aptor.
P.M.: Bolo’Bolo.
Niccolò Machiavelli: Der Fürst.
Dietmar Dath: Venus siegt.
Wissenschaftliche Literatur
Bei wissenschaftlicher Literatur gestaltet sich die Liste schwieriger, da ich – wie wohl die meisten Wissenschaftler – die wenigsten Bücher von vorne bis hinten durcharbeite. Die folgenden Titel habe ich aber alle mehr oder weniger komplett gelesen. Etwas vom Besten war dabei David Wittenbergs Studie zu Zeitreise-Erzählungen. Im Bereich Utopie war ich besonders von der Arbeit von Susanna Layh sowie dem Klassiker von Peter Kuon angetan.
Einige der folgenden Titel habe ich rezensiert; Links zu den Besprechungen folgen, sobald diese erschienen sind.
Werder, Peter R.: Utopien der Gegenwart. Zwischen Tradition, Fokussierung und Virtualität. Zürich 2009. → Amazon
Rohgalf, Jan: Jenseits der großen Erzählungen. Utopie und politischer Mythos in der Moderne und Spätmoderne. Mit einer Fallstudie zur globalisierungskritischen Bewegung. Wiesbaden 2015. → Amazon
Johnson, Steven: Everything Bad is Good for You. London 2006. → Amazon
Tietgen, Jörn: Die Idee des Ewigen Friedens in den politischen Utopien der Neuzeit. Analysen von Schrift und Film. Marburg 2005. → Amazon
Wittenberg, David: Time Travel. The Popular Philosophy of Narrative. New York 2013. → Amazon
Case, George: Calling Dr. Strangelove. The Anatomy and Influence of the Kubrick Masterpiece. Jefferson 2014. → Amazon
Kuon, Peter: Utopischer Entwurf und fiktionale Vermittlung. Studien zum Gattungswandel der literarischen Utopie zwischen Humanismus und Frühaufklärung. Heidelberg 1986. → Amazon
Layh, Susanna: Finstere neue Welten. Gattungsparadigmatische Transformationen der literarischen Utopie und Dystopie. Würzburg 2014. → Amazon
Schmid, Sonja: Im Netz der Filmgenres. The Lord of the Rings und die Geschichtsschreibung des Fantasygenres. Marburg 2014. → Amazon (siehe meine Rezension).
Chapman, James: Licence to Thrill. A Cultural History of the James Bond Films. 2. Aufl. London/New York 2007. → Amazon
Stoppe, Sebastian: Unterwegs zu neuen Welten. Star Trek als politische Utopie. Darmstadt 2014. → Amazon
Fritzsche, Sonja (Hg.): The Liverpool Companion to World Science Fiction Film. Liverpool 2014. → Amazon (siehe meine Rezension)
Gabler, Neal: An Empire of Their Own: How the Jews Invented Hollywood. New York 1988. → Amazon
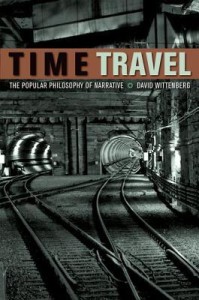

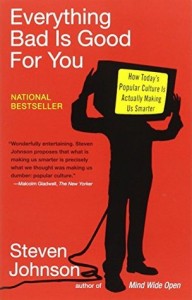
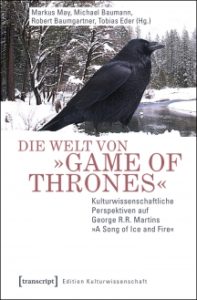 Mit Fantasy habe ich eigentlich wenig am Hut. Lord of the Rings habe ich vor Jahren gelesen, ohne dass es grossen Eindruck auf mich gemacht hätte, Harry Potter hat mich nach dem dritten Band nicht mehr sonderlich interessiert, und die neueren Fantasy-Blockbuster schaue ich mir – wenn überhaupt – eher aus Pflichtgefühl, denn aus genuinem Interesse an. Eine grosse Ausnahme bildet aber die Fernsehserie Game of Thrones, die mich restlos begeistert (ok, nicht völlig restlos. Staffel 5 und 6 konnten nicht ganz an die vorangegangenen Höhepunkte anschliessen).
Mit Fantasy habe ich eigentlich wenig am Hut. Lord of the Rings habe ich vor Jahren gelesen, ohne dass es grossen Eindruck auf mich gemacht hätte, Harry Potter hat mich nach dem dritten Band nicht mehr sonderlich interessiert, und die neueren Fantasy-Blockbuster schaue ich mir – wenn überhaupt – eher aus Pflichtgefühl, denn aus genuinem Interesse an. Eine grosse Ausnahme bildet aber die Fernsehserie Game of Thrones, die mich restlos begeistert (ok, nicht völlig restlos. Staffel 5 und 6 konnten nicht ganz an die vorangegangenen Höhepunkte anschliessen).