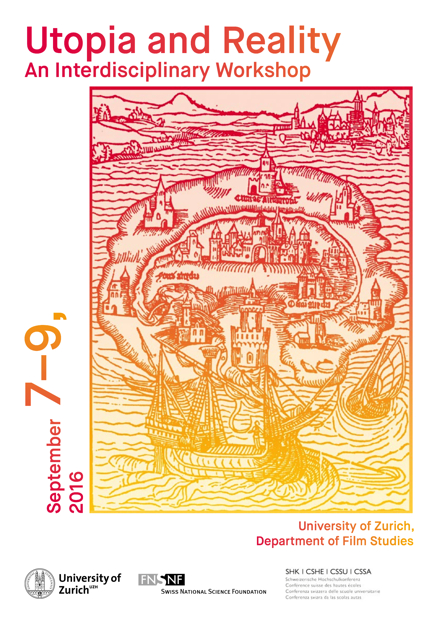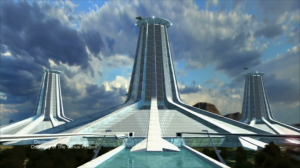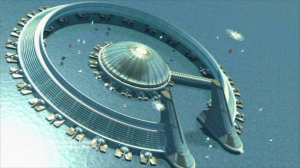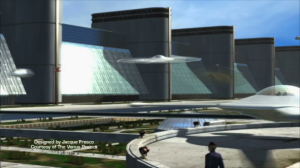In der Zeitschrift Komparatistik Online ist dieser Tage ein Teil der Proceedings der letzten Jahrestagung der Gesellschaft für Fantastikforschung erschienen — unter anderem darin enthalten ist ein Artikel von mir zur Utopie im nicht-fiktionalen Film.
Das Timing ist nicht ganz optimal, da ich mich in dem Artikel u.a. auf einen Text beziehe, den ich für die Proceedings der 2012er Jahrestagung geschrieben habe, welche voraussichtlich erst im Herbst erscheinen werden. Ich denke aber, dass der Artikel auch so verständlich sein sollte. Kurz zum Inhalt: Grundthese meines Forschungsprojekts ist, dass es im nicht-fiktionalen Film (vulgo: Dokumentarfilm) zahlreiche Beispiele für utopische Entwürfe gibt, die dem von Thomas Morus in Utopia etablierten Modell weitgehend entsprechen. Ein Beispiel hierfür, das ich im besagten noch nicht veröffentlichten Artikel analysiere, ist Zeitgeist: Addendum von Peter Joseph, ein Low-Budget-Film (auf YouTube frei erhältlich), der neben viel verschwörungstheoretischem Geraune mit dem Venus Project auch einen Gegenentwurf präsentiert. Das Venus Project wiederum ist zwar durchaus ernst gemeint, präsentiert sich aber als einzige Ansammlung utopischer Topoi. Sei es Geldlosigkeit, zentrale Verteilung der Güter, Erziehung zum besseren Menschen, Abschaffung des politischen Prozesses – das Venus Project bietet die volle Packung.
Während ich in dem nun später erscheinenden ersten Artikel ganz grundlegend dafür plädiere, den Dokumentarfilme für die Utopieforschung zu erschliessen, konzentriere ich mich in dem in Komparatistik Online erschienenen Aufsatz auf die Frage, wie sich ein Film wie Zeitgeist: Addendum aus Sicht der Dokumentarfilm-Theorie präsentiert. Denn auf den ersten Blick erscheint ein solcher utopischer Film als Paradoxon: Ausgerechnet im Dokumentarfilm, der die Wirklichkeit abbildet, soll es utopische Entwürfe geben, zu deren wesentlichen Eigenschaften es gehört, dass sie (noch) nicht existieren. Bei genauerer Betrachtung ist die Sache freilich gar nicht so widersprüchlich. Dass Dokumentarfilme die Wirklichkeit keineswegs einfach abbilden, dass das Verhältnis zwischen Realität und Film einiges komplexer ist, dürfte jedem klar sein, der sich ein bisschen in diesem Bereich auskennt. Das macht die Sache aber nicht einfacher, und die Filmtheorie müht sich schon seit geraumer Zeit mit der Frage ab, wie das Verhältnis zwischen Dokumentarfilm und Wirklichkeit am besten zu fassen ist. Persönlich scheint mir der semiopragmatische Ansatz von Roger Odin hier am sinnvollsten. Sehr vereinfacht gesagt geht dieser davon aus, dass ein Film vom Rezipienten immer auf verschiedene Arten gelesen werden kann, und dass die unterschiedlichen Lektüre-Modi sowohl durch formale Merkmale im Film – z.B. Kameraführung, Einsatz von Off-Kommentar, Montage – wie auch durch den Kontext, in dem der Film rezipiert wird, nahegelegt werden. Wenn ein Film z.B. als Dokumentarfilm beworben wird, liegt es nahe, dass ich als Zuschauer den dokumentarisierenden Modus wähle. Es stet mir aber immer frei, entgegen der Vorgaben, die ein Film resp. der Kontext macht, einen anderen Lektüremodus zu wählen.
Der dokumentarisierende Modus unterscheidet sich vom fiktionalisierenden unter anderem dadurch, dass ich als Zuschauer immer davon ausgehe, dass der Filmemacher Aussagen zur Wirklichkeit macht. Das heisst nun nicht, dass die Bilder und Töne im Film tatsächlich reale Ereignisse wiedergeben müssen, aber dass ich seinen Inhalt in Bezug zur Realität setze, dass der Film als Ganzer dem Wahrheitsgebot unterliegt. Zugespitzt formuliert: Ein Dokumentarfilm kann lügen, ein Spielfilm nicht. Der Filmtheoriker Carl Plantinga, der diesbezüglich ähnlich argumentiert wie Odin, spricht von einer assertorischen Haltung.
Was geschieht nun, wenn ein Dokumentarfilm Dinge zeigt, die es offensichtlich nicht gibt, wenn zum Beispiel in Zeitgeist: Addendum die computeranimierten Entwürfe von Venus-Project-Guru Jacque Fresco zu sehen sind? Verliert der Film dann seinen dokumentarischen Status? Ich bin der Ansicht, dass das nicht der Fall ist, denn an der grundsätzlichen Haltung des Films ändert sich nichts. Folgendes Zitat aus dem Artikel bringt den Sachverhalt – hoffentlich – auf den Punkt:
Die in Josephs Film gezeigten futuristischen Bauten und Gefährte sind zweifellos (noch) nicht real, im Kontext des Films verändern sie aber ihren Status und erscheinen nicht als völlig fiktive Elemente. Vielmehr ist die Argumentation des Films gerade darauf ausgerichtet, das Gezeigte als plausibel und wünschenswert erscheinen zu lassen. Mittels dieser Strategie verliert das Fiktive seine ursprüngliche Nicht-Wirklichkeit und erhält einen quasi-assertorischen Status. Diesen Vorgang, das Quasi-real-Erscheinen-lassen fiktiver Elemente, bezeichne ich als Faktualisierung (195 f.)
Faktualisierung führt also dazu, dass fiktive Elemente in einem Dokumentarfilm ihren nicht-realen Status zumindest teilweise verlieren. Das heisst nun keineswegs, dass Frescos Entwürfe damit automatisch plausibel werden. Aber auch ein Skeptiker, der das Venus Project für Unsinn hält, wird wohl zugestehen, dass dessen futuristische Städte einen anderen Status haben als die Metropolen eines Science-Fiction-Films. Ein Film wie Blade Runner erhebt keinen Anspruch darauf, eine ernsthafte Prognose zur Stadtentwicklung in den USA abzugeben. Fresco versteht seine Entwürfe dagegen ausdrücklich als ernsthafte Vorschläge, über welche man diskutieren und die man schliesslich auch umsetzen soll.
Mit dem Begriff der Faktualisierung, der übrigens von meiner Projektpartnerin Andrea Reiter stammt, scheint mir ein für mein Projekt ganz wesentliches Element benannt. Momentan haben wir dieses Konzept noch nicht detailliert ausgearbeitet, sondern nur grob skizziert. Auch mein Artikel ist nur als erster Entwurf zu verstehen, der das Phänomen des utopischen Dokumentarfilms aus filmtheoretischer Sicht umreisst. Ich bin aber zuversichtlich, dass sich der Ansatz als fruchtbar erweisen wird. Der Vorgang der Faktualisierung scheint mir dabei für viele Spielarten des Dokumentarfilms relevant, im Falle der von mir untersuchten utopischen Filme bildet er aber das zentrale Scharnier zwischen Fiktion und Faktualität.